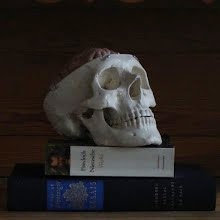Bevor jetzt aber jemand auf die Idee kommt zu vermuten, der Bezug auf Gottesfurcht im staatlichen Erziehungswesen würde zum guten Abschneiden im nationalen Bildungsvergleich beitragen, sei noch darauf hingewiesen, dass zwar mit Baden-Württemberg (Platz 3) und Bayern (Platz 4) gottesfürchtige Länder vordere Plätze belegen. Hingegen rangiert Rheinland-Pfalz (Platz 8) im Mittelfeld und Nordrhein-Westfalen (Platz 15) trotz Verweis auf den lieben Gott sogar an vorletzter Stelle. Sachsen (Platz 1) und Thüringen (Platz 2) indes kommen offenbar ganz gut auch ohne Verweis auf höhere Mächte hinsichtlich der Erziehung aus. (Wobei man allerdings einräumen muss, dass der Verweis auf Gott auch in div. Präambeln gegeben ist, z.B. in Niedersachsen und Thüringen.)
Nunja, vielleicht gilt ja auch im Bezug auf das Bildungswesen: "Sire, ich hatte diese Hypothese nicht nötig..." Womit sie sich bequem herauskürzen ließe...
(Quelle für die Platzierungen: Bildungsmonitor)
Hier mal die entsprechenden Artikel der jeweiligen Landesverfassungen:
Verfassung des Landes Baden-Württemberg
Artikel 12
(1) Die Jugend ist in Ehrfurcht vor Gott, im Geiste der christlichen Nächstenliebe, zur Brüderlichkeit aller Menschen und zur Friedensliebe, in der Liebe zu Volk und Heimat, zu sittlicher und politischer Verantwortlichkeit, zu beruflicher und sozialer Bewährung und zu freiheitlicher demokratischer Gesinnung zu erziehen.
(Quelle)
Verfassung des Freistaates Bayern
Artikel 131
(1) Die Schulen sollen nicht nur Wissen und Können vermitteln, sondern auch Herz und Charakter bilden.
(2) Oberste Bildungsziele sind Ehrfurcht vor Gott, Achtung vor religiöser Überzeugung und vor der Würde des Menschen, Selbstbeherrschung, Verantwortungsgefühl und Verantwortungsfreudigkeit, Hilfsbereitschaft, Aufgeschlossenheit für alles Wahre, Gute und Schöne und Verantwortungsbewußtsein für Natur und Umwelt.
(3) Die Schüler sind im Geiste der Demokratie, in der Liebe zur bayerischen Heimat und zum deutschen Volk und im Sinne der Völkerversöhnung zu erziehen.
(4) Die Mädchen und Buben sind außerdem in der Säuglingspflege, Kindererziehung und Hauswirtschaft besonders zu unterweisen.
(Quelle)
Verfassung für das Land Nordrhein-Westfalen
Artikel 7
(1) Ehrfurcht vor Gott, Achtung vor der Würde des Menschen und Bereitschaft zum sozialen Handeln zu wecken, ist vornehmstes Ziel der Erziehung.
(2) Die Jugend soll erzogen werden im Geiste der Menschlichkeit, der Demokratie und der Freiheit, zur Duldsamkeit und zur Achtung vor der Überzeugung des anderen, zur Verantwortung für Tiere und die Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen, in Liebe zu Volk und Heimat, zur Völkergemeinschaft und Friedensgesinnung.
(Quelle)
Verfassung für Rheinland-Pfalz
Artikel 33
Die Schule hat die Jugend zur Gottesfurcht und Nächstenliebe, Achtung und Duldsamkeit, Rechtlichkeit und Wahrhaftigkeit, zur Liebe zu Volk und Heimat, zum Verantwortungsbewußtsein für Natur und Umwelt, zu sittlicher Haltung und beruflicher Tüchtigkeit und in freier, demokratischer Gesinnung im Geiste der Völkerversöhnung zu erziehen.
(Quelle)
- Verfassung von Berlin (Artikel 20)
- Verfassung des Landes Brandenburg (Artikel 28)
- Verfassung der Freien Hansestadt Bremen (Artikel 26)
- Verfassung der Freien und Hansestadt Hamburg (---)
- Verfassung des Landes Hessen (Artikel 56)
- Verfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern (Artikel 15)
- Niedersächsische Verfassung (Artikel 33)
- Verfassung des Saarlandes (Artikel 26)
- Verfassung des Freistaates Sachsen (Artikel 101)
- Verfassung des Landes Sachsen-Anhalt (Artikel 27)
- Verfassung des Landes Schleswig-Holstein (Artikel 8)
- Verfassung des Freistaats Thüringen (Artikel 22)